-
 Premierensieg für Taubitz im Olympia-Winter
Premierensieg für Taubitz im Olympia-Winter
-
Rettungsschwimmer am Bondi Beach in Sydney gedenken der Anschlagsopfer

-
 NBA: OKC verspielt Sieg - Knicks-Serie endet
NBA: OKC verspielt Sieg - Knicks-Serie endet
-
Musk gewinnt Berufung zu milliardenschwerem Gehaltspaket bei Tesla

-
 K.o.-Sieg in Miami: Joshua schickt Paul zu Boden
K.o.-Sieg in Miami: Joshua schickt Paul zu Boden
-
Konkurrenzkampf im DFB-Tor: Johannes bleibt "entspannt"

-
 Dreesen sieht "gute Gründe" für Upamecano-Verbleib in München
Dreesen sieht "gute Gründe" für Upamecano-Verbleib in München
-
Lipowitz: "Radsport ist nicht alles für mich"

-
 Kehl sieht "positive Entwicklung" beim BVB - und will mehr
Kehl sieht "positive Entwicklung" beim BVB - und will mehr
-
Gedenken ein Jahr nach Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt mit Kanzler Merz

-
 Nach tödlichem Angriff auf Soldaten: USA greifen mehr als 70 IS-Ziele in Syrien an
Nach tödlichem Angriff auf Soldaten: USA greifen mehr als 70 IS-Ziele in Syrien an
-
Nach tödlichem Angriff auf US-Soldaten: USA starten Militäroperation gegen IS in Syrien

-
 Kehl: Geldstrafe für Adeyemi nach Wutausbruch
Kehl: Geldstrafe für Adeyemi nach Wutausbruch
-
Epstein-Akten: Trump-Regierung verfehlt Freigabe-Frist

-
 Nach Schlotterbeck-Kritik: BVB siegt am 116. Geburtstag
Nach Schlotterbeck-Kritik: BVB siegt am 116. Geburtstag
-
US-Regierung veröffentlicht Teil der Epstein-Akten
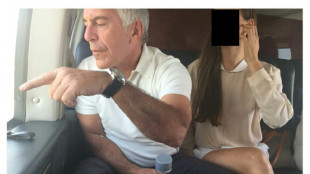
-
 Gouverneur: Mindestens sieben Tote bei russischem Raketenangriff in Region Odessa
Gouverneur: Mindestens sieben Tote bei russischem Raketenangriff in Region Odessa
-
Achte Pleite in Serie: Bayern in der EuroLeague im freien Fall

-
 Trumps Name prangt fortan an renommiertem Kulturzentrum in Washington
Trumps Name prangt fortan an renommiertem Kulturzentrum in Washington
-
Brasilien: Gericht lehnt Berufung von Ex-Präsident Bolsonaro ab

-
 US-Außenminister Rubio spielt AfD-Kontakte herunter
US-Außenminister Rubio spielt AfD-Kontakte herunter
-
Weitere Runde von Ukraine-Verhandlungen in Florida - Europäer beteiligt

-
 Ausgleich in letzter Sekunde: Dämpfer für Hertha BSC
Ausgleich in letzter Sekunde: Dämpfer für Hertha BSC
-
Darmstadt verspielt Sieg in Paderborn

-
 Shein entgeht Sperre seiner Plattform in Frankreich - Paris kündigt Berufung an
Shein entgeht Sperre seiner Plattform in Frankreich - Paris kündigt Berufung an
-
Treffen zwischen Vertretern der USA, Europas und der Ukraine am Freitag

-
 Positiver Dopingtest: Taylor von Darts-WM ausgeschlossen
Positiver Dopingtest: Taylor von Darts-WM ausgeschlossen
-
Russland-Nähe: Polnischer Außenminister verleiht Orban symbolisch Lenin-Orden

-
 Kramp-Karrenbauer wird Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung
Kramp-Karrenbauer wird Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung
-
Kramp-Karrenbauer zur Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung gewählt

-
 Skispringer Hoffmann überrascht: Quali-Sieg in Engelberg
Skispringer Hoffmann überrascht: Quali-Sieg in Engelberg
-
Fed-Mitglied: Inflationszahlen der Trump-Regierung zu positiv

-
 Trump billigt Gesetz: 76.000 US-Soldaten bleiben vorerst in Europa
Trump billigt Gesetz: 76.000 US-Soldaten bleiben vorerst in Europa
-
Umfrage: 45 Prozent der Deutschen empfinden Smartphones an Heiligabend als störend

-
 Epstein-Akten: US-Regierung will zunächst nur Teile veröffentlichen
Epstein-Akten: US-Regierung will zunächst nur Teile veröffentlichen
-
Trump drängt Kiew bei Friedensgesprächen zur Eile - Putin sieht Westen und Kiew am Zug

-
 Trump drängt Kiew bei Friedensgespräche zur Eile - Putin sieht Westen und Kiew am Zug
Trump drängt Kiew bei Friedensgespräche zur Eile - Putin sieht Westen und Kiew am Zug
-
Mit angeblich sicheren Tresorfächern: Betrüger erbeuten mehrere hunderttausend Euro

-
 Bundesgerichtshof bestätigt Betrugsurteil gegen früheren Audi-Chef Stadler
Bundesgerichtshof bestätigt Betrugsurteil gegen früheren Audi-Chef Stadler
-
Bundesrat beschließt höhere Strafen und strengere Regeln für E-Scooter

-
 Landgericht Mannheim verhängt Haftstrafen wegen Verkaufs von Luxusautos nach Russland
Landgericht Mannheim verhängt Haftstrafen wegen Verkaufs von Luxusautos nach Russland
-
Nach Einigung im Vermittlungsausschuss: Sparpaket für Krankenkassen kann kommen

-
 Biathlon: Nawrath im Sprint auf Platz zehn
Biathlon: Nawrath im Sprint auf Platz zehn
-
Baden-Württemberg: 19-Jähriger soll 65-Jährigen getötet haben

-
 Frau in hessischer Klinik mit Armbrust erschossen: Mordurteil gegen 59-Jährigen
Frau in hessischer Klinik mit Armbrust erschossen: Mordurteil gegen 59-Jährigen
-
Gaza-Gespräche in Miami: Hamas fordert Ende israelischer "Verstöße" gegen Waffenruhe

-
 Hinterrücks mit Beil angegriffen: 51-Jähriger wegen Tötung von Onkel verurteilt
Hinterrücks mit Beil angegriffen: 51-Jähriger wegen Tötung von Onkel verurteilt
-
Bundesverfassungsgericht verhandelt im Februar über Weg zu Heizungsgesetz

-
 Onlinehändler Shein entgeht einer Sperre seiner Plattform in Frankreich
Onlinehändler Shein entgeht einer Sperre seiner Plattform in Frankreich
-
Weltkriegsbombe in ehemaligem Tanklager entschärft: Evakuierungen in Bremen

Medien: Credit Suisse akzeptierte jahrelang Kriminelle als Kunden
Die Schweizer Großbank Credit Suisse soll Medienberichten zufolge jahrelang korrupte Autokraten und Kriminelle als Kunden akzeptiert haben. Mutmaßliche Kriegsverbrecher, Menschen- oder Drogenhändler hätten bei Credit Suisse Konten eröffnen oder behalten können, auch wenn die Bank Straftaten zumindest bereits vermuten musste, berichteten die "Süddeutsche Zeitung" und andere Medien unter Verweis auf ihr zugespielte Kundendaten. Die Bank wies die Anschuldigungen zurück.
Die Unterlagen zu den "Suisse Secrets" genannten Enthüllungen umfassen laut den an den Recherchen beteiligten Medien Informationen zu tausenden Bankkonten, die teils bis in die 40er Jahre zurückreichen. Unter den Kunden befinden sich demnach etwa ein auf den Philippinen verurteilter Menschenhändler, ein jemenitischer Spionagechef, der in Folter verwickelt war, ein serbischer Drogenbaron sowie ein 2008 wegen Bestechung verurteilter früherer Siemens-Manager, dessen zwischenzeitliches Millionen-Vermögen mit seinem Gehalt nicht zu erklären sei.
Banken sind gesetzlich zur Überprüfung ihrer Kunden verpflichtet. Große Vermögen ungeklärter Herkunft und Verdachtsfälle auf Straftaten müssen sie melden. Die vorliegenden Daten legen laut "SZ" mutmaßliche Versäumnisse der Bank nahe.
Die Credit Suisse wies die Vorwürfe "entschieden" zurück. Die Berichte beruhten auf Daten, die "unvollständig, ungenau oder aus dem Zusammenhang gerissen sind, was zu einer tendenziösen Darstellung des Geschäftsverhaltens" der Bank führe, hieß es in einer Stellungnahme des Kreditinstituts. Zudem seien 90 Prozent der betroffenen Konten bereits geschlossen worden, "davon mehr als 60 Prozent vor 2015". Die Bank kündigte eine Untersuchung bezüglich des Datenlecks an.
In der Schweiz gilt eines der strengsten Bankgeheimnisse der Welt. Die Weitergabe von Kontoinformationen steht unter Strafe und auch Journalisten droht Strafverfolgung. Deshalb beteiligte sich kein Medium aus der Schweiz an den Recherchen. Das rechtliche Risiko sei einfach zu groß gewesen, erklärte etwa die größte private Mediengruppe TX zur Begründung.
Kritiker werten dies als massive Einschränkung der Pressefreiheit. "Es würde gegen die internationalen Menschenrechtsvorschriften verstoßen, wenn man Journalisten strafrechtlich verfolgt oder bestraft, weil diese Bankinformationen veröffentlichen, die von öffentlichem Interesse sind", erklärte laut "SZ" Irene Khan, die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit. Sie leitete demnach eine Untersuchung ein.
Die "SZ" wertete die ihr vor rund einem Jahr zugespielten Daten gemeinsam mit dem NDR und dem WDR und internationalen Medien wie "Le Monde" und der "New York Times" im Rahmen des Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) aus. Woher die Daten stammen, ist den Medien nach eigenen Angaben nicht bekannt. Die Quelle habe als Motiv Kritik am Schweizer Bankgeheimnis genannt: "Der Vorwand, die finanzielle Privatsphäre zu schützen, ist lediglich ein Feigenblatt, um die schändliche Rolle der Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern zu verschleiern", erklärte sie demnach.
Die Credit Suisse war in der jüngeren Vergangenheit bereits von mehreren Skandalen betroffen. So gehört etwa in der Schweiz ein ehemaliger Mitarbeiter des Kreditinstituts zu den Angeklagten in einem großen Korruptionsprozess, bei dem es um mutmaßliche Geldwäsche und organisierte Kriminalität in Bulgarien geht.
Der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Christian Görke, wertete die "Suisse Secrets" als weiteres "Puzzle-Stück", das das "riesige Ausmaß der Steuervermeidung, der Geldwäsche und der Terrorfinanzierung" zeige. Zugleich sei es die erste Enthüllung aus einer Schweizer Großbank und damit ein "Meilenstein für die Öffentlichkeit".
Nötig seien mehr Transparenz, mehr internationaler Informationsaustausch, weniger Schlupflöcher im Transparenzregister und Straf- oder Quellensteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen, forderte Görke. "Die Ampel-Regierung hat versprochen hier Fortschritte zu liefern - jetzt wäre eine guter Moment."
M.Furrer--BTB

